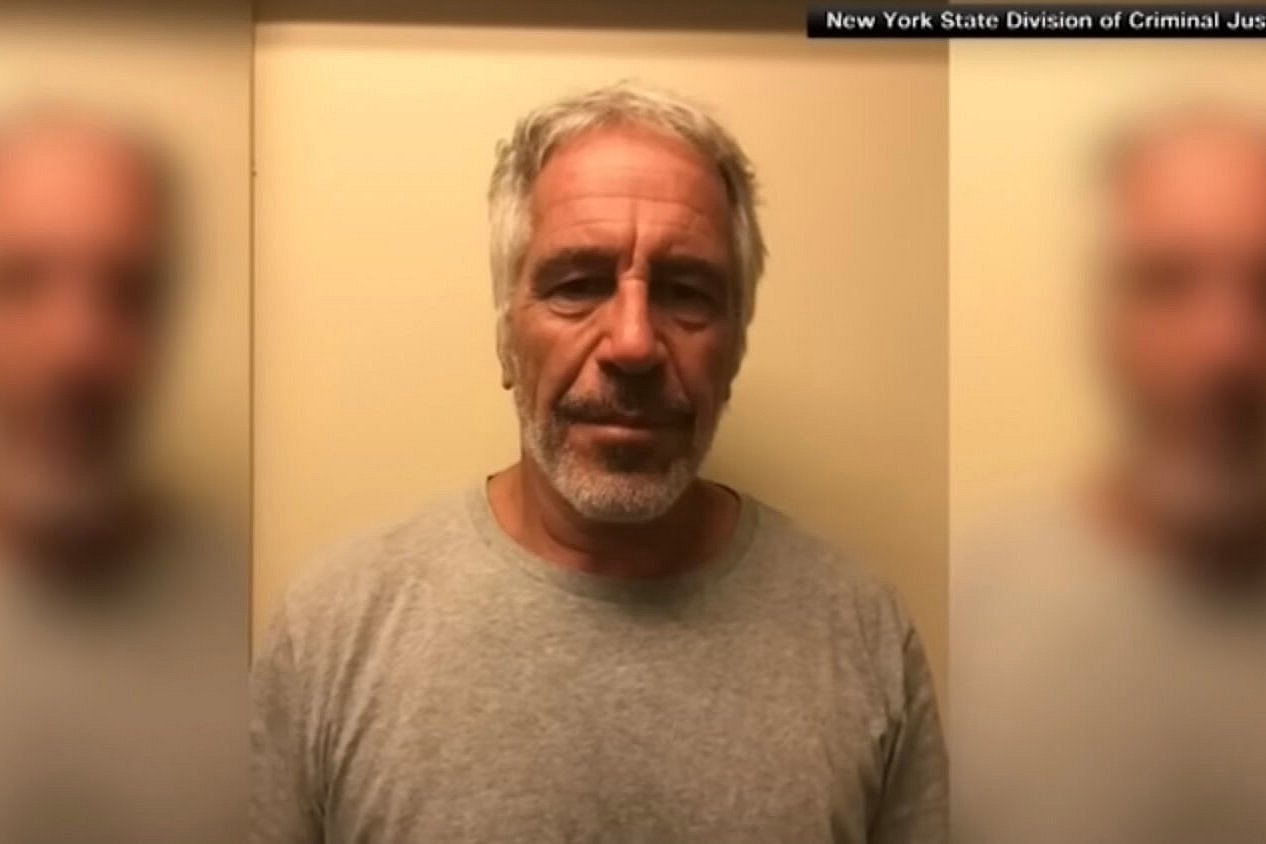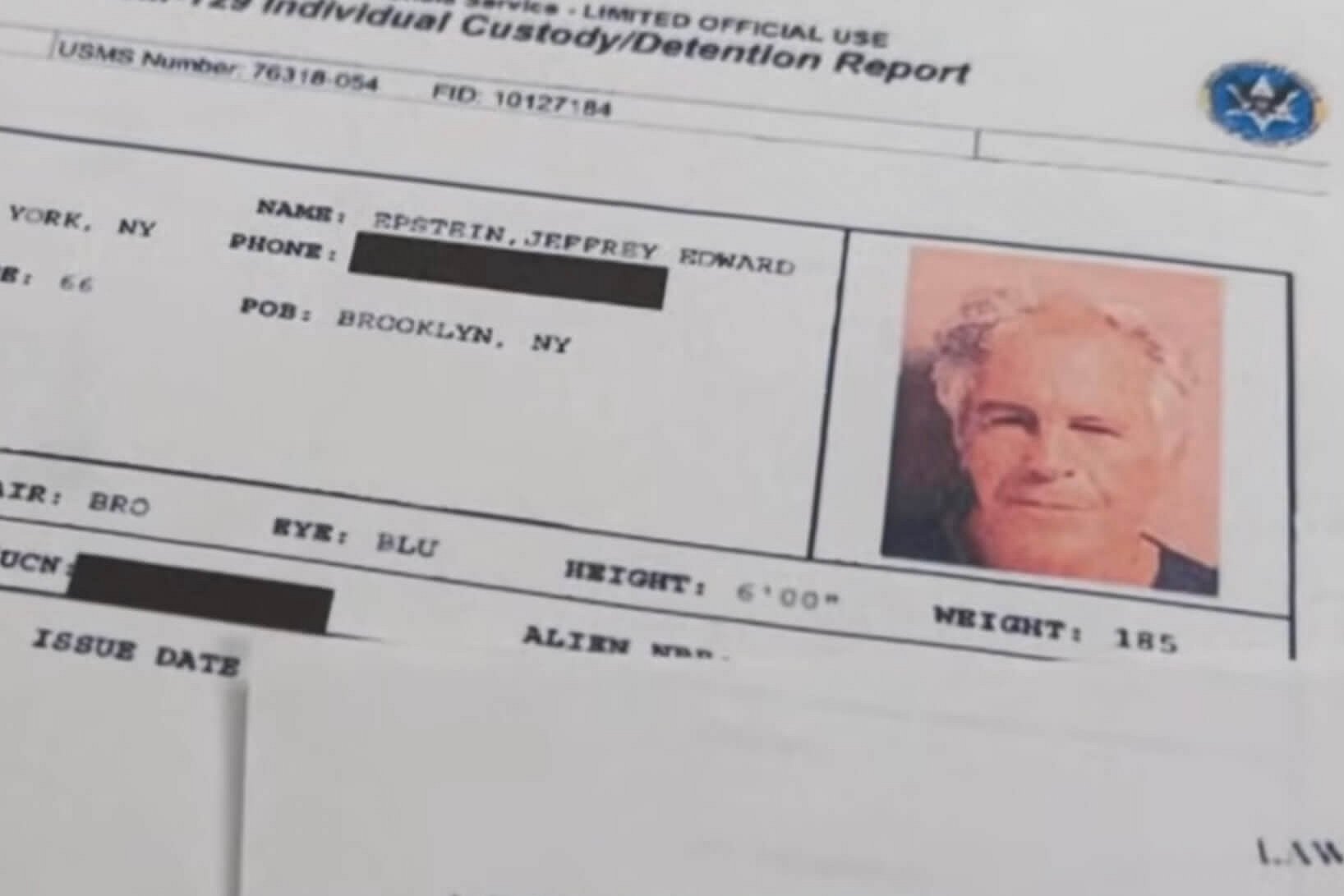„Flucht durch Klimawandel“: António Guterres, der jetzige Generalsekretär der Vereinten Nationen und von 2005 bis 2015 Hoher UN-Flüchtlingskommissar, erklärte 2009 auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen: „Der Klimawandel könnte zum Hauptfluchtgrund werden. Er verstärkt den Wettstreit um die Ressourcen – Wasser, Nahrungsmittel, Weideland –, und daraus können sich Konflikte entwickeln.“
Laut der Netzseite uno-fluechtlinghilfe.de bewirken Naturkatastrophen „mehr als dreimal so viele Vertreibungen“ wie Gewalt und Konflikte. Das Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), eine 1998 vom norwegischen Flüchtlingsrat in Genf gegründete Nichtregierungs-Organisation, präsentiert Informationen und Analysen zu Binnenvertreibungen weltweit. Nach Erhebungen des IDMC haben 2022 rund 32,6 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von Katastrophen und „klimabedingten Ereignissen“ wie Dauerregen, langanhaltenden Dürren, Hitzewellen oder Stürmen verlassen müssen. Gegenüber 2008 verzeichnet die Organisation einen Anstieg von 41 Prozent. Dabei handelt es sich, wie die UN-Flüchtlingshilfe im November 2023 feststellte, um „Binnenvertreibungen“, wobei über grenzüberschreitende Bewegungen nach Katastrophen „weniger Daten“ vorlägen.
Doch ohnehin hätten jene Menschen, „die gezwungen sind, ein vom Klimawandel stark betroffenes Gebiet zu verlassen, … auch seltener die Mittel, über weite Strecken zu fliehen“, heißt es an die Adresse besorgter Europäer gerichtet. Vielfach entspreche der Klimawandel einem „Bedrohungs-Multiplikator“, und zwar verstärke er die Auswirkungen anderer Faktoren, die zu einer Vertreibung beitragen können, so zum Beispiel Armut oder Spannungen im Zusammenhang mit schwindenden Ressourcen oder religiöse bzw. Stammeskonflikte. Als Beispiel wird Burkina Faso angeführt, wo zuletzt Gewalttaten und Vertreibungen stattfanden, die sicherlich auch im Zusammenhang mit Wasserquellen und Ackerland stehen. Infolge der Komplexität sei es „schwierig zu sagen, wie viele Vertreibungen allein dem Klimawandel zugeschrieben werden können“.
Genfer Flüchtlings-Konvention kennt Begriff "Klimaflüchtling" nicht
In den Medien wird dabei immer wieder der Begriff „Klimaflüchtlinge“ verwendet. Doch gibt es diese Kategorie überhaupt? Die UN-Flüchtlingshilfe verneint dies unter Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Gilt doch als Flüchtling im Völkerrecht jemand, der aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aufgrund seiner politischen Überzeugung Verfolgung oder Bedrohung erfährt und deshalb sein Land verläßt. Nicht dazu zählen hingegen Menschen, die aus persönlichen oder materiellen Notlagen – wie Hunger oder Umweltzerstörung – fliehen.
Trotzdem können Naturkatastrophen oder eine Zerstörung von Lebensgrundlagen natürlich Fluchtbewegungen über Ländergrenzen nach sich ziehen – ein Aspekt, der im UN-Migrationspakt auch Erwähnung findet. Betroffene haben dann einen berechtigten Anspruch auf Erteilung des Flüchtlingsstatus, wenn die „Auswirkungen des Klimawandels“ mit bewaffneten Konflikten und Gewalt zusammenwirken. In der 1984 von zehn lateinamerikanischen Staaten verabschiedeten Erklärung von Cartagena wurde in Abschnitt III, Absatz 3 die Flüchtlings-Definition erweitert. So heißt es: „... Personen, die aus ihrem Land geflüchtet sind, weil ihr Leben, ihre Sicherheit oder Freiheit durch allgemeine Gewalt, den Angriff einer ausländischen Macht, interne Konflikte, massive Verletzung der Menschenrechte oder sonstige Umstände, die zu einer ernsthaften Störung der öffentlichen Ordnung geführt haben, bedroht sind.“
Ein "historisches" Urteil
Derweil scharrt die Umweltorganisation Greenpeace ungeduldig mit den Hufen. Ortrun Sadik, Texterin bei Greenpeace, forderte in einem am 19. Juni 2023 erschienenen Beitrag, das „Problem der Vertreibung durch Klimawandel“ endlich anzupacken. „Das heißt zum einen, daß diese Menschen einen – wie auch immer gearteten – Status erhalten müssen: einen, der ihnen Rechte einräumt, wenn sie ihr eigenes Land verlassen müssen, und der ihnen internationalen Schutz gewährt. Zum zweiten müssen die gefährdetsten und verwundbarsten Länder dieser Erde von den reichen Industrienationen (die immerhin den Klimawandel verursacht haben) finanziell bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden.“
Ob Frau Sadik deswegen die eine oder andere schlaflose Nacht verbringt, wissen wir nicht. Doch kann man sie in gewisser Weise beruhigen. Vier Jahre ist es her, daß der UN-Menschenrechts-Ausschuß ein Urteil fällte, dessen Entscheidung seinerzeit vom Menschenrechts-Büro der Vereinten Nationen als „historisch“ bezeichnet worden ist. Verhandelt wurde damals die Beschwerde eines Mannes aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati. Ioane Teitiota hatte 2014 mit seiner Familie in Neuseeland um Aysl nachgesucht, war aber 2015 ausgewiesen worden. Teitiota führte als maßgeblichen Grund für seine Flucht den steigenden Meeresspiegel an, der die Inseln seines Heimatstaates unbewohnbar mache. So gehe auch die Fläche für den Ackerbau zurück. Außerdem sei das Trinkwasser zunehmend mit Salzwasser kontaminiert. Die vormalige britische Kolonie hat eine Landfläche von zirka 800 Quadratkilometern – weniger als die Insel Rügen in Vorpommern. Auf den zahlreichen Inseln leben um die 120.000 Menschen.

Ioane Teitiota versuchte, als erster Mensch der Welt in Neuseeland offiziell als Klimaflüchtling anerkannt zu werden.
Der Ausschuß lehnte einerseits die Beschwerde ab, da es auf Kiribati nachweislich genügend Schutzmechanismen für die Bevölkerung gäbe. Andererseits hatte das Gremium aber noch eine weitere Feststellung getroffen: Länder dürften Asylsuchende nicht ausweisen, wenn die klimabedingte Situation in ihrer Heimat ihr Recht auf Leben bedrohe. „Dieser Beschluß etabliert neue Standards, die den Erfolg in Fällen künftiger Asylgesuche, die sich auf die Folgen des Klimawandels beziehen, leichter machen können“, bewertete Yuval Shany, ein Ausschußmitglied, die Entscheidung.
57 Prozent der Weltbevölkerung leben in Städten – Tendenz steigend
Die damalige Bundesregierung verhielt sich vorsichtig-ablehnend: „Die meisten Studien deuten darauf hin, daß Umweltveränderungen Auslöser, aber nicht alleinige Ursache von Migrationsentscheidungen sind“, ließ ein Sprecher des Innenministeriums die Medien wissen. Das bundesdeutsche Aufenthaltsrecht gewährt aber auch hier eine Hintertür. So sei von Abschiebungen abzusehen, wenn im Herkunftsland „eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht“. Im jetzigen rot-grünen Polit-Biotop würden „Klimaflüchtlinge“ auf offene Arme treffen, wie die eine oder andere Verlautbarung zeigt.
Fest steht aber auch, daß in der sogenannten Dritten Welt viele Menschen aufgrund von Armut oder eben infolge von Umweltfaktoren ihre meist ländliche Umgebung verlassen und in die Städte abwandern. Laut Statistischem Bundesamt lebten zur Jahresmitte 2023 schätzungsweise 4,6 der etwas mehr als acht Milliarden Menschen in Städten, was 57 Prozent der Weltbevölkerung entsprach. 2030 wird dieser Anteil voraussichtlich 60 Prozent betragen. Diese Entwicklung betrifft besonders stark Asien und Afrika – mit fatalen Folgen. Werden doch die dortigen Metropolen weiter wachsen oder besser: wuchern. Denn immer mehr Boden wird für Siedlungen und Verkehrswege benötigt, woraus zum einen eine fortschreitende Versiegelung und zum zweiten ein Verlust von Flächen für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung, Wasser und auch frischer Luft resultiert.
Ein klassisches Beispiel für das Zusammenwirken von natürlichen Gegebenheiten, Eingriffen des Menschen in das sensible Gefüge der Natur und Umweltkatastrophen liefert Bangladesch. Gewiß, das Staatsgebiet besteht zu einem gut Teil aus Gebieten, die vom Hochwasser gefährdet sind. Ganges und Brahmaputra haben ein weit verästeltes Delta aufgeschüttet, eine geradezu amphibische Landschaft, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt. In die Hochwasserzone der schlickreichen Seichtwasserküste wächst ein Mangrovenwald in das Meer hinein.

Schwere Überschwemmungen in Bangladesch – die Kinder nehmen es spielerisch.
Zudem hat Bangladesch – bezogen auf sein Staatsgebiet von 147.600 qkm (weniger als halb so groß wie die Bundesrepublik) – eine extrem hohe Bevölkerungsdichte. 2023 belief sie sich auf 1240 Einwohner auf den Quadratkilometer. In dem fast völlig von Indien umschlossenen Land leben 172,1 Mio. Menschen (2013: 158 Mio.).
Ein massiver ökologischer Raubbau
Alljährlich kommt es in Bangladesch zu Szenen, die Milliarden vor den Bildschirmen verfolgen können: Siedlungen und landwirtschaftlich genutzte Territorien werden vom Hochwasser überflutet, wozu zum einen die starken Niederschläge während der Monsunzeit und zum anderen das Hochwasser während der Schneeschmelze im Himalaya beitragen. Und wenn dann noch tropische Wirbelstürme vom Golf von Bengalen aus auf die Küste prallen, ist das Unglück perfekt: Meterhohe Flutwellen überschwemmen die küstennahen Gebiete.
In solchen Situationen wird vom medialen Mainstream im Zusammenspiel mit Politikern und Umweltorganisationen zur Erklärung wie auf Knopfdruck der „Klimawandel“ bemüht, so wie 2016 im Deutschlandfunk: Bangladesch sei besonders vom „Klimawandel“ betroffen: „Die Flüsse führen mehr Wasser, die Böden senken sich, der Meeresspiegel steigt.“ Wohltuende Ursachenforschung findet sich dagegen auf dem Portal diercke.de. Demnach wurde in Bangladesch in den zurückliegenden Jahrzehnten ein massiver ökologischer Raubbau betrieben. Konkret geht es um den Holzeinschlag im Mangrovenwald und im Khasi-Gebirge.
Weiter heißt es in dem Beitrag: „Die Ausweitung der landwirtschaftlichen Anbauflächen durch Brandrodung hat an ganzen Bergflanken zu Kahlschlägen geführt. Die Regenmassen der Sommermonate spülen dort den Boden ab. Früher versickerten sie allmählich im Waldboden, und das schützende Blätterdach verminderte den Aufprall. Der Boden speicherte die Feuchtigkeit und gab sie in den trockeneren Monaten ab. Heute lagert sich der abgespülte Boden als Sediment in den Flußarmen des Deltas ab; die Schlammfracht erhöht die Flußsohle und die Ufer. Bei den großen Abflußmengen nützen Dämme daher nur wenig. Gewaltige Überschwemmungen sind die Folge.“
Mittlerweile gibt es in Bangladesch ein Frühwarnsystem, wird versucht, mit der Errichtung von Betonwänden der alljährlichen Hochwassermassen Herr zu werden. Und: Vor einigen Jahren wurde in den Küstenbereichen mit der Wiederaufforstung von Mangrovenwäldern begonnen.
Im großen ganzen wäre es übrigens unfair, allein die Menschen in Bangladesch oder anderen Drittwelt-Ländern für ökologische Verwerfungen verantwortlich zu machen. Im Gegenteil: Die Ausbeutung der eigenen Ressourcen – hier: Holz – folgt der Globalisierung, die es bereits zur Zeit des Kolonialismus gab und deren weltweite Arbeitsteilung wirtschaftliche Monokulturen hervorbrachte. Um an dringend benötigte Devisen zu gelangen, wurde die heimische Natur ohne Rücksicht auf Verluste ausgebeutet.
Plantagenwirtschaft und Monokulturen
Zuweilen liefern selbst Organisationen wie die UNO-Flüchtlingshilfe keine tiefgründigen Erklärungen, sondern nur wohlgedrechselte Sätze. So lesen wir in einem Beitrag, Titel: „Klimawandel als Fluchtgrund“: „Begrenzte natürliche Ressourcen, wie Trinkwasser, werden sicherlich noch knapper. Viele Feldfrüchte und einige Vieharten werden in bestimmten Gebieten nicht überleben können, wenn es zu heiß und trocken oder zu kalt und naß wird. Die Lebensmittelversorgung ist in vielen Regionen der Welt schon jetzt ein Grund zur Sorge.“ Die Frage nach dem Warum wird aber einmal mehr nicht gestellt. Warum werden viele Feldfrüchte nicht überleben können und warum ist die Lebensmittelversorgung „in vielen Regionen der Welt schon jetzt ein Grund zur Sorge“?
Bleiben wir ruhig beim Feldbau. Vielfach wird hier, beispielsweise im Falle der Baumwolle, eine großflächige Landwirtschaft in Form von Plantagen betrieben. Vor allem in Afrika, aber auch in Teilen Asiens haben wir es dabei mit einer Agrarwirtschaft zu tun, die überwiegend auf Monokulturen ausgerichtet ist – ein Erbe der Kolonialzeit, das schlimme Folgen für Umwelt und Mensch hat, zumal diese Form der Bewirtschaftung durch einen starken Einsatz von Pestiziden und einen hohen Wasserverbrauch gekennzeichnet ist. Zur natürlichen Anreicherung der Böden mit Nährstoffen bleibt in diesem System keine Zeit mit der Folge, daß es langfristig zu einer Auslaugung des Erdreiches kommt. Die Erträge werden immer schlechter. Auch breiten sich Pflanzenkrankheiten und Schädlinge aus, womit eine fatale Entwicklung in Gang gesetzt wird: Um die Ernten zu sichern, sind die Bauern gezwungen, in immer größerem Umfang Pestizide und Düngemittel anzuwenden. Am Ende stehen die Menschen vor dem Nichts, da unfruchtbares Ödland zurückbleibt – und wandern in die ohnehin schon überfüllten Metropolen ab, wo sie die Zahl der Proletarier vermehren und der Grad der Versiegelung durch die Schaffung neuer Wohnbauten und Straßen noch erhöht wird.

Monokulturen schaden dem Boden und den Menschen. Künstliche Bewässerung riesiger Monokulturen in der Wüste.
Auch der mit der monokulturellen Plantagenwirtschaft verbundene hohe Wasserverbrauch durch künstliche Bewässerung zeitigt negative Folgen. Kommt es dabei doch häufig zu Erosionen und zu einer Versalzung der Böden. Der Grundwasserspiegel sinkt; Flüsse oder Feuchtgebiete trocknen aus – und das Trinkwasser für Mensch und Tier wird zu einem knappen Gut.
Natürliche Bodenanreicherung durch Fruchtwechsel
Doch es geht auch anders. Die von dem Unternehmer Prof. Dr. Michael Otto ins Leben gerufene Initiative „Cotton Made in Africa“ (CMIA) verfolgt das Ziel, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern. Der Anbau der Baumwolle erfolgt dabei durch Kleinbauern in Subsahara-Afrika unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien. So findet ein Fruchtwechsel – beispielsweise mit Leguminosen, Soja oder Erdnüssen – statt, wodurch es zu einer natürlichen Anreicherung der Böden mit Nährstoffen kommt. Geerntet wird per Hand im Regenfeldanbau. In speziellen Schulungen lernen die Kleinbauern moderne und effiziente Anbaumethoden kennen, die mit einem möglichst geringen Pestizideinsatz verbunden sind.
Die Organisation „Brot für die Welt“ unterstützt weltweit Kleinbauern in der Anlage von lokalen Saatgut-Banken oder auch bei der Lagerung, Vermehrung oder Eigenzucht von Saatgut, was einen durchaus ernsten Hintergrund hat, wie Stig Tanzmann, Referent für Landwirtschaft bei „Brot für die Welt“, im November 2022 in einem Interview erklärte: Schon während der Kolonialzeit habe es Bestrebungen gegeben, „traditionelles Saatgut durch angeblich verbessertes industrielles Saatgut zu ersetzen und Bäuerinnen und Bauern in Richtung Monokulturen zu führen. Später setzten dann viele Länder auf eine ,nachholende Entwicklung‘ und orientierten sich an den Anbausystemen und Wünschen des Globalen Nordens. In der Folge wurde vor allem die Produktion von Exportfrüchten wie Mais, Baumwolle oder Soja unterstützt, um Devisen zu erwirtschaften. Der Anbau traditioneller Sorten ist seit der Kolonisierung meist nicht mehr gefördert worden.“ Zudem werde ein Teil der Nahrungsmittel „für andere Zwecke mißbraucht: für Massentierhaltung und Agrartreibstoffe“.

Kleinstrukturierte Landwirtschaften bieten mehr Menschen Arbeit und gesunde naturbelassene Nahrung.
Sogenannten Hochleistungssorten stehen Tanzmann und seine Mitstreiter ablehnend gegenüber: „Sie erfordern den Einsatz von mineralischem Dünger, weil sie nur dann ertragreich sind, wenn sie genügend Stickstoff, Phosphor und Kalium bekommen.“ Seit Beginn des Ukraine-Konfliktes sei Dünger aber nur schwer und wenn, nur zu hohen Preisen zu bekommen, was kleinere Bauern aber finanziell überfordere. Die Alternative erblickt Tanzmann in der Wiederbelebung traditioneller Sorten wie beispielsweise Hirse: Diese „enthalten oft sehr viel mehr Nähstoffe, sind dürreresistenter und benötigen weniger Düngemittel als zum Beispiel Mais“. Zudem sei es für die Bauern möglich, ihre Samen immer wieder auszusäen und nicht stets und ständig Dünger kaufen zu müssen, „der ja auch schädlich für die Böden und das Trinkwasser sein kann“. Auch Tanzmann setzt auf ein Fruchtfolge-System.
Großflächiger Landkauf durch kapitalkräftige Eliten
Überhaupt reicht es nicht, die – an sich lobenswerte und oft privat betriebene – Entwicklungshilfe auf den Bau von Brunnen und Schulen zu beschränken. Denn aus Kindern und Jugendlichen werden Erwachsene, die Arbeitsplätze benötigen. Geschaffen werden könnten sie durch eine Weiterverarbeitung afrikanischer Produkte bzw. Rohstoffe in den jeweiligen Regionen. Einem solchen System, das mehr Wertschöpfung vor Ort beläßt, stehen aber derzeit noch die europäischen Agrarsubventionen und die vom Westen propagierte Freihandels-Doktrin entgegen.
Ein weiteres Problem: der Kauf von afrikanischem Ackerland durch finanzkräftige Investoren. Wie die globale Datenbank „Landmatrix“ feststellte, wurden allein zwischen 2000 und 2016 von börsennotierten Unternehmen, Investmentfonds oder lokalen Eliten etwa zehn Millionen Hektar Ackerland erworben. Auf Staaten südlich der Sahara entfallen dabei 42 Prozent aller weltweiten Landakquisitionen. Das katholische Hilfswerk Misereor wollte dazu mehr wissen und führte 2021 eine Studie durch, in der Wissenschaftler 399 jener Landdeals untersuchten – und zu einem erschreckenden Ergebnis gelangten. Nur auf elf Prozent der Landfläche wurde produziert. Der Agrarwissenschaftler Markus Wolter, der die Untersuchung betreute, reagierte bestürzt: „Da verlieren Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihre Äcker zugunsten von Investoren, werden vielleicht sogar vertrieben, und dann wird ein Großteil der Fläche landwirtschaftlich nicht genutzt. Das hat mich wirklich schockiert.“
Doch warum liegen eigentlich für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehene Flächen einfach brach? Laut Misereor-Report könnten mangelnde Informationen über das Ertragspotential der Flächen oder Probleme beim Import von Produktionsmitteln maßgeblich sein, aber auch die Spekulation mit Boden und Wasser könne eine Rolle spielen.
Überhaupt bringe die großflächig betriebene Landwirtschaft den Menschen vor Ort nur wenig. Ein Großteil der Ernte von Betrieben mit einer Fläche über 200 Hektar gehe in den Export. Demgegenüber erzeugten Kleinbauern auf ihren meist weniger als zwei Hektar umfassenden Flächen Gemüse, Früchte und Getreide für den Eigenverbrauch und den lokalen Markt. Die Schlußfolgerung liegt auf der Hand: „Mit dem Wechsel von kleinbäuerlichen Strukturen hin zur industriellen Produktion ist meist ein effektiver Rückgang der Lebensmittel-Produktion in der Region verbunden“, heißt es in der Studie.
Kleinbäuerliche Strukturen halten Menschen vor Ort
Auch im Hinblick auf die Zahl der benötigten Arbeitskräfte fällt die Bilanz aus Sicht des Großgrundbesitzes eher negativ aus. Er benötigt – je nach der angebauten Kultur – statistisch zwischen 0,1 und 1,0 Arbeitskräfte auf den Hektar, kleinbäuerliche Strukturen hingegen bis zu 3,77. „Es gibt in dieser Form der traditionellen Landwirtschaft quasi keine Arbeitslosigkeit, weil sie so viele Hände braucht“, streicht Wolter einen maßgeblichen Trumpf der kleinbäuerlichen Betriebe heraus. Nach Großinvestitionen aber verloren laut dem Misereor-Report viele Menschen ihre Beschäftigung.
Mit dem Zugang zu Land, Saatgut und Wasser könne auch auf kleineren Flächen agrarökologisch sehr ertragreich gewirtschaftet werden, um die Nachfrage des heimischen Marktes entsprechend zu befriedigen. Gerade für jüngere Menschen böte die kleinräumige, arbeitsintensive Bewirtschaftung eine echte Perspektive. Monokulturen aber samt ihren Folgen, die großflächige Plantagenwirtschaft und eine gewissenlose Bodenspekulation treiben viele Menschen vom Land in die ohnehin schon überfüllten Metropolen, deren Versiegelungsrad noch mehr verstärkt wird und die damit anfälliger für Naturereignisse wie Hochwasser werden. Und fassen die in die Städte Abgewanderten auch dort nicht Fuß, entschließen sich viele zur Flucht übers Mittelmeer.
Hierbei handelt es sich bei weitem nicht ausschließlich um „Klimaflüchtlinge“, um einmal in der Diktion des medialen Mainstreams zu bleiben, sondern um Opfer einer kapitalistischen Verwertungs- und Profitmaximierungslogik, die ihre eigenen Unzulänglichkeiten seit einigen Jahren mit dem „Klima“-Etikett zu kaschieren versucht. Auf der anderen Seite würde (der wohl noch bevorstehende große) Ansturm auf Europa dort die Bevölkerungsdichte erhöhen, den Flächenverbrauch verstärken und neben ethnischen auch ökologische Verwerfungen hervorrufen.
Hierbei handelt es sich bei weitem nicht ausschließlich um „Klimaflüchtlinge“, um einmal in der Diktion des medialen Mainstreams zu bleiben, sondern um Opfer einer kapitalistischen Verwertungs- und Profitmaximierungslogik, die ihre eigenen Unzulänglichkeiten seit einigen Jahren mit dem „Klima“-Etikett zu kaschieren versucht. Auf der anderen Seite würde (der wohl noch bevorstehende große) Ansturm auf Europa dort die Bevölkerungsdichte erhöhen, den Flächenverbrauch verstärken und neben ethnischen auch ökologische Verwerfungen hervorrufen.