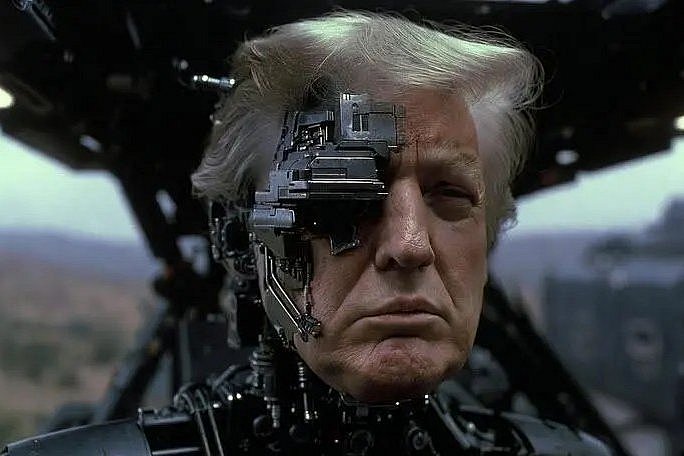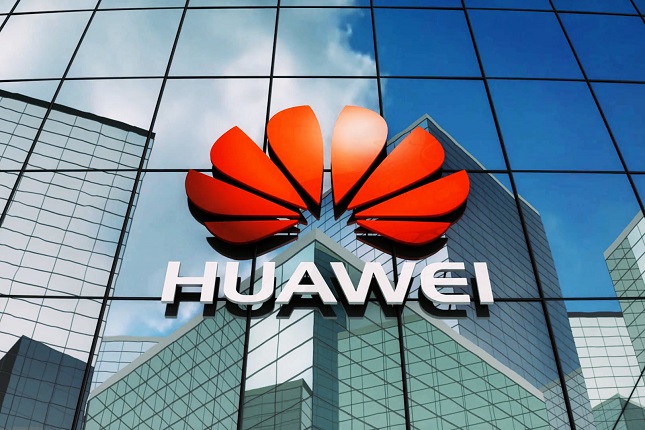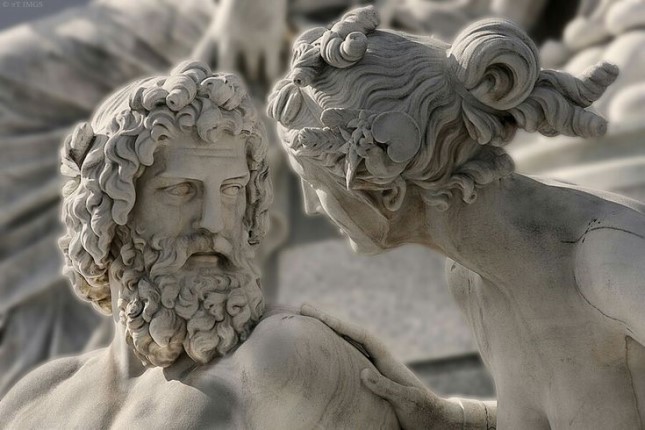Künftige Historiker werden den 25. Oktober 2025 womöglich als den Tag bezeichnen, der die Energiewende in Deutschland endgültig besiegelt hat. Oder aber als den Tag, an dem die Bundesrepublik seine Zukunft in die Luft gejagt und seinen Kurs als globaler Geisterfahrer manifestiert hat. Vor gut einer Woche wurden die beiden Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen im Landkreis Günzburg (Bayern) medienwirksam gesprengt. Klare Botschaft: Die Atomkraft gehört in Deutschland der Vergangenheit an, Comeback unerwünscht und ausgeschlossen!
Während hierzulande am einst leistungsstärksten Kernkraftwerk der Nation Fakten geschaffen wurden, investiert gefühlt die ganze Welt in eben diese Technologie – und zwar aus purer Notwendigkeit heraus. Nur mithilfe der Atomkraft, so die allgemeine Überzeugung außerhalb Deutschlands, lässt sich der Energiehunger des KI-Zeitalters stillen. So gaben etwa die USA in der vergangenen Woche bekannt, in den kommenden Jahren mindestens 80 Milliarden Euro (69 Milliarden Dollar) in die Reaktivierung und den Neubau von Atomkraftwerken investieren zu wollen.
Die Trump-Regierung gab in diesem Zusammenhang eine strategische Partnerschaft mit den beiden Unternehmen Westinghouse und Cameco bekannt. Mit dem Bau neuer Reaktoren solle „die industrielle Basis der Kernenergie wiederbelebt“ werden, wie es in einer Erklärung der Partner heißt. Bürokratische Hürden sollen abgebaut und so der Weg zu einer Vervierfachung des erzeugten Atomstroms innerhalb der nächsten 25 Jahre geebnet werden.
USA: Strategische Partnerschaften sichern KI-Zukunft
Aber auch die Tech-Konzerne selbst wollen kräftig in neue Rechenzentren und die dafür notwendige Infrastruktur investieren. Beispielhaft hierfür stehen Google und das Unternehmen Nextera Energy, die den im Jahr 2020 abgeschalteten Meiler Duane Arnold im US-Bundesstaat Iowa bis spätestens 2029 wieder ans Netz bringen wollen. Dieser soll dann Energie für neue KI-Anwendungen liefern. Kostenpunkt: geschätzte 1,6 Milliarden Dollar. Amazon und Meta arbeiten an ähnlichen Projekten und Partnerschaften.
Und Deutschland? Hier scheint der KI-Boom an der ewigen Frage des „Entweder Oder“ zu entscheiden. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage, die von AlgorithWatch und weiteren NGOs in Auftrag gegeben wurde, stimmen über zwei Drittel (69 Prozent) der 1.002 Befragten der Aussage zu, dass neue Rechenzentren nur dann gebaut werden sollen, wenn diese mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Fast ebenso viele (66 Prozent) fordern demnach sogar, dass durch den Bau von KI-Rechenzentren zusätzliche Kapazitäten an erneuerbaren Energien geschaffen werden sollten.
Immer noch deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen macht sich zudem Sorgen um den Wasserverbrauch von Rechenzentren (57 Prozent) bzw. deren negativen Einfluss auf benachbarte Ökosystem (63 Prozent). In den Augen von Julian Bothe, KI- und Klimaschutz-Manager bei AlgorithmWatch, werde der „KI-Hype unweigerlich zum Klimakiller“. Für in diesem Zuge neu entstehende Rechenzentren brauche es deshalb „zwingend auch zusätzliche erneuerbare Energie“.
Scheitert Deutschland wieder an einer grünen Illusion?
Doch aus diesem grünen Traum dürfte nichts werden. Ein großes Stück vom künftig zu verteilenden KI-Kuchen abzubekommen, dabei aber vollständig auf Atomkraft zu verzichten und weitgehend auf die Erneuerbaren zu setzen, scheint der Quadratur des Kreises zu gleichen. Schon heute liegt der Strombedarf der in Deutschland aktiven Rechenzentren nach Angaben der Bundesnetzagentur bei 20 bis 26 Terawattstunden (TWh) pro Jahr, was knapp vier Prozent des gesamten Verbrauchs entspricht. Bis zum Jahr 2037 wird sich dieser Bedarf auf geschätzt 78 bis 116 TWh vervielfachen und dann rund 10 Prozent des bundesweiten Gesamtverbrauchs ausmachen.
Was auffällt: Bei der von einschlägigen NGOs beauftragten Umfrage spielte die Kernkraft überhaupt keine Rolle. Sowohl bei den Fragestellungen als auch den Bewertungen der Auftraggeber ging es in der Regel nur um „Erneuerbare“ oder fossile Energieträger wie Kohle und Gas. Wie auch in dieser exemplarischen Aussage von Julian Bothe: „Es bringt überhaupt nichts, wenn ein neues Rechenzentrum sich einen grünen Sticker an die Fassade klebt, weil es mit erneuerbaren Energien betrieben wird, wenn dann für das Unternehmen nebenan doch wieder ein Kohle- oder Gaskraftwerk anspringen muss.“
Dieser Logik mag man durchaus folgen. Umso verwunderlicher ist es, dass man sich in Deutschland der emissionsarmen Atomkraft mit einer solchen Vehemenz verschließt. Denn auch hier zeigen die USA, dass die Frage des „grünen KI-Booms“ keine Frage des Entweder Oder sein muss, sondern vielmehr auch auf ein „Sowohl als auch“ hinauslaufen kann.
Im US-Bundesstaat Texas erfolgte in der vergangenen Woche der Spatenstich für einen Solarpark, der künftig bis zu 600 Megawatt Strom für neue Rechenzentren liefern soll. Hinter dem Projekt stehen Meta und der französische Konzern Engine. Gleichzeitig investiert der Facebook-Mutterkonzern in ein altes Atomkraftwerk in Illinois, das im Jahr 2027 eigentlich hätte vom Netz gehen sollen, jetzt aber wieder auf Vordermann gebracht werden soll.
So können also auch mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Deutschland freilich hat sich solchen Möglichkeiten selbst beraubt und läuft jetzt Gefahr, den weltweiten Anschluss an eine Zukunftstechnologie, die unweigerlich kommen und von größter Bedeutung sein wird, erneut zu verlieren.