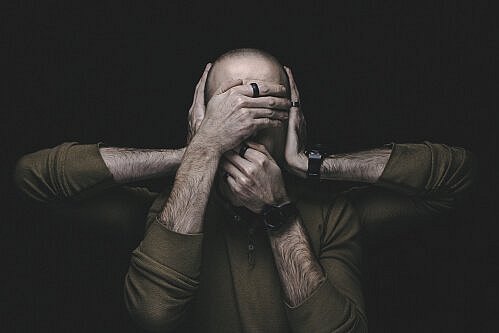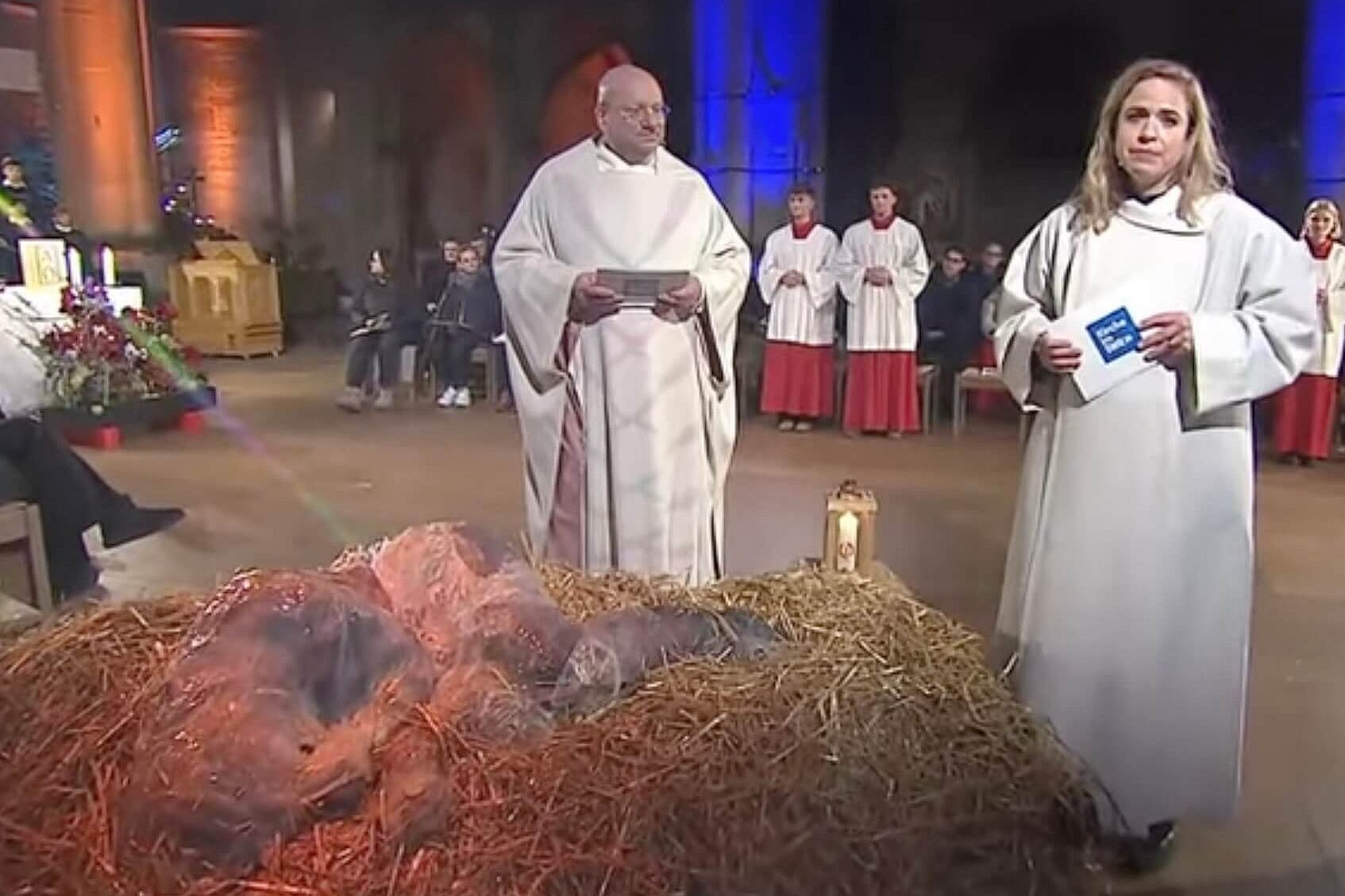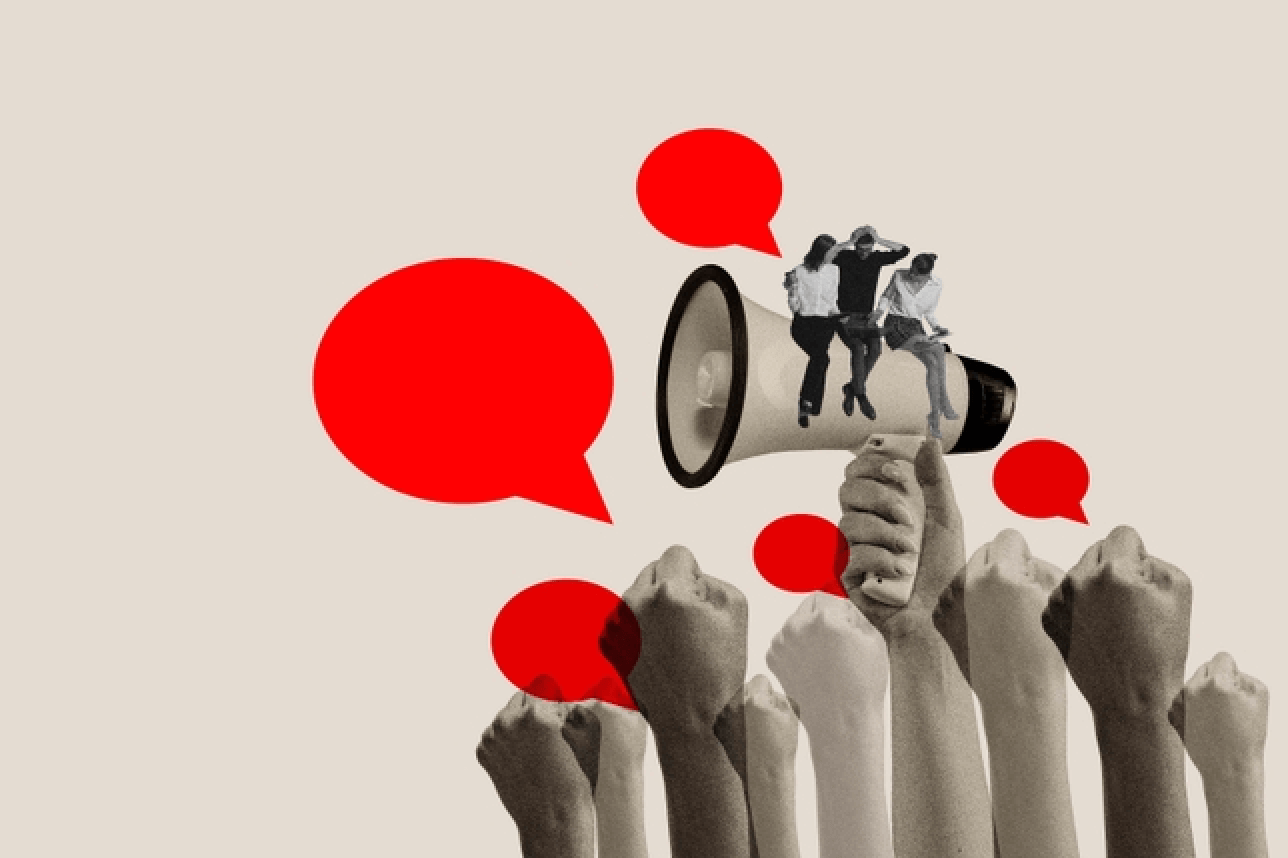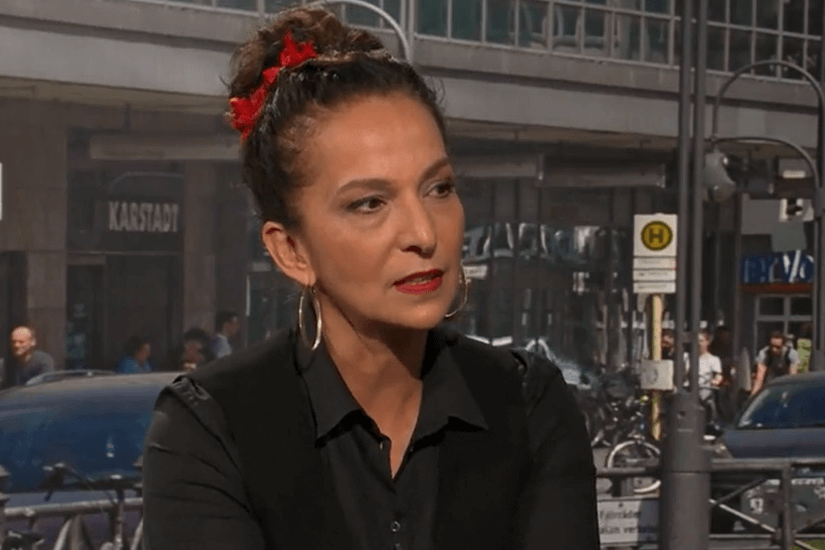Meine Tochter wollte es mit mir ansehen, und ich wollte eigentlich nur kurz durchatmen. Ein bisschen seichte Unterhaltung zur Ablenkung. „Emily in Paris“. Nie gehört. Fünf Minuten, dann ausmachen, dachte ich. Doch daraus wurde eine ganze Folge. Dann noch eine. Irgendetwas daran zog mich an. Die Farben. Die Mode. Die Leichtigkeit. Und ja, vielleicht auch die Hauptdarstellerin.
Aber irgendwann – etwa Mitte der ersten Staffel – kam das Gefühl, das man hat, wenn man zu viel Zuckerwatte gegessen hat: Übelkeit. Nicht wegen der Handlung, nicht wegen der Dialoge. Sondern weil ich spürte, dass mir hier etwas verkauft wird, das weit über Kitsch hinausgeht. Eine Lebenshaltung. Ein Weltbild. Und das in einer Verpackung, die so süß und glatt ist, dass man sich dagegen kaum wehren kann.
Ab einem bestimmten Punkt konnte ich Emily kaum noch ertragen. Sie stieß mich regelrecht ab, trotz ihrer Attraktivität. Ich schaute weiter, das sage ich mir zumindest, aus soziologischem Interesse. In Wahrheit war es wohl auch die perfekte Ästhetik, die mich einfing. Die Bilder. Die Mode. Der Zuckeräther, der aus dem Bildschirm waberte.
„Emily in Paris“ ist eine Serie, die vorgibt, harmlos zu sein – und genau das macht sie so gefährlich. Sie verkauft Ideologie als Leichtigkeit. Wokeness als Coolness. Und moralische Bevormundung als modernes Selbstverständnis.
Was hier im Hintergrund läuft, ist nichts weniger als die Umsetzung der sogenannten „woken Agenda“. Netflix und Co. sind dabei nicht neutral. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Verbreitung eines Weltbildes, das jungen Menschen systematisch eintrichtert: Du musst offen sein, tolerant, korrekt – aber bitte immer im Rahmen des vorgegebenen Narrativs. Alles wirkt, als wäre es Vielfalt, doch in Wirklichkeit ist es Konformität. Wer davon abweicht, ist verdächtig. Und genau diese Art der schöngeschminkten Indoktrination macht Streaming-Plattformen wie Netflix so wirkmächtig. Sie prägen keine Meinung. Sie prägen Bewusstsein.
Die Hauptfigur ist eine Art woke Barbie mit Diplom: hübsch, charmant, moralisch unangreifbar. Sie lächelt, sie belehrt, sie rettet Werbekampagnen, zwischenmenschliche Beziehungen und gleich das ganze Pariser Lebensgefühl. Und das alles mit einer penetranten Freundlichkeit, die fast schon an Gewalt grenzt.
Emily ist toxisch – aber nicht auf die klassische, manipulative Weise. Sondern durch Tugend. Durch ihre Unfähigkeit zur echten Reibung, zur dunklen Seite, zur Tiefe. Sie ist ein wandelndes PR-Plakat für politische Korrektheit. Und gerade das macht sie so unerträglich. Und so wirksam.
Denn sie wirkt. Die Serie zieht Millionen an. Weil sie auf unheimlich geschickte Weise genau die Bedürfnisse bedient, die Menschen heute haben: ein bisschen Glanz, ein bisschen Drama, ein bisschen Moral – aber bitte ohne Schmerz, ohne Ambivalenz, ohne Risiko.
Sie ist die perfekte Illusion von Liebe, ohne Leidenschaft. Von Erfolg, ohne Konflikt. Von Moral, ohne Anstrengung. Und dabei verkauft sie ein Weltbild, das auf Anpassung basiert: Der gute Mensch ist, wer funktioniert, wer niemandem zu nahe tritt, wer immer positiv bleibt.
Noch bizarrer wird es, wenn man die Nebenfiguren betrachtet. Etwa Gabriel, der love interest: ein kochender Posterboy mit der psychologischen Tiefe eines Weinglases. Und Emily? Sie springt zwischen ihm, ihrem Freund Alfie, der wie eine Karrikatur wirkt, und dem nächsten Kandidaten, von einem Bett ins nächste, ohne dass es je um echte Gefühle ginge. Die ganze Romantik ist inszeniert wie ein Werbespot für Parfum – viel Nebel, keine Substanz. Gabriel ist dabei so eindimensional, dass man fast Mitleid hat: Selbst ein Disney-Prinz und ein Weinglas haben mehr Tiefgang.
Oder Sylvie, Emilys Chefin, die als angeblich „sexuell begehrenswerte“ Powerfrau inszeniert wird – obwohl sie aussieht, als wäre sie die verbitterte Nebenrolle in einem 90er-Jahre-Krimi. Zuerst dachte ich noch, das sei Parodie. Eine Überzeichnung, eine ironische Brechung. Aber nein: Die Macher meinen es ernst. Sylvie soll tatsächlich als begehrenswerte Frau inszeniert werden. Ihr junger Lover ist kein Stilmittel, sondern Programm. Und genau das macht es so grotesk.
Und diese Bemerkung von mir ist nicht frauenfeindlich gemeint. Es ist eine Kritik an der Realitätsverzerrung, die hier betrieben wird: Der Zuschauer soll nicht mehr empfinden, was ist – sondern was ideologisch gewünscht ist.
Und dann ist da noch diese Randnotiz, die sinnbildlich für alles steht: In der ersten Staffel taucht ein männlicher Chef auf, Besitzer der Pariser Agentur. Er ist kaum gezeichnet, wirkt alt, weiß, traditionsbewusst. Und dann? Verschwindet er. Wortlos. Wie ausgelöscht. Stattdessen übernehmen zwei Frauen das Ruder, mit viel Stil, Haltung und Haltungssätzen. Zufall? Oder die perfekte kleine Chiffre für das, was diese Serie wirklich zeigt: Die schönste Art, eine Welt zu entmännlichen.
Der Gipfel der Absurdität ist eine Szene in Staffel 3: Dort erwähnt einer der Nebenfiguren ein Buch, das ihn früher prägte: die erotischen Tagebücher von Anaïs Nin. Eine echte Schriftstellerin, eine radikale Stimme weiblicher Lust und Freiheit. Und dieser kurze Verweis wirkt wie ein ironischer Hohn: Denn im Kosmos von „Emily in Paris“ ist echte Erotik genauso tabu wie echte Emotion.
Was „Emily in Paris“ wirklich macht:
Sie verkauft Oberflächlichkeit als Tiefe
Konformismus als Selbstverwirklichung
Austauschbare Affären als große Gefühle
Und Ideologie als Unterhaltung.
Die stille Gehirnwäsche: Solche Serien formen das, was Soziologen das „kulturelle Imaginäre“ nennen: Unsere Vorstellungen davon, was Liebe ist. Was Erfolg ist. Was richtig, was falsch ist. Und „Emily“ predigt unterschwellig:
Sei immer freundlich – Konflikte sind toxisch.
Sei immer offen – aber hab nie echte Haltung.
Sei unabhängig – aber funktioniere im System.
Sei feministisch – aber bitte in Chanel.
Und: Männer sind nur gut, wenn sie gefällig, witzig und devot sind.
Die neue Toxizität: Zucker mit Abgrund. Sie lächelt. Sie belehrt. Sie „empowert“. Und dabei hinterlässt sie eine Spur der Entseelung, wie ein moralischer Terminator mit Selfie-Stick.
Toxisch, weil sie:
emotional steril ist, aber vorgibt, tief zu empfinden.
jeden Konflikt sofort neutralisiert, statt ihn auszuhalten.
keine Haltung hat, sondern nur positive Markenbotschaften.
immer nur „correct“, nie wahrhaftig, nie verletzbar.
alles „respektiert“, aber nichts wirklich kennt.
Und das ist das Perfide: Wer sie kritisiert, klingt automatisch wie der Sexist, der Misogyn, der Reaktionär. Dabei ist es nicht frauenfeindlich, eine künstlich geschaffene Puppe zu durchschauen, die echte Weiblichkeit ersetzt hat durch Marketing-Feminismus.
Emily ist nicht Frau – sie ist Funktion.
Warum zieht das trotzdem so an? Weil es genau das tut, was gute Propaganda immer tut: Sie verpackt die Botschaft so, dass sie nicht mehr wie eine Botschaft aussieht. Sondern wie Unterhaltung. Wie Lifestyle. Wie Instagram.
Und genau deshalb ist sie so gefährlich. Nicht weil sie laut ist, sondern weil sie leise wirkt. Nicht weil sie etwas befiehlt, sondern weil sie etwas suggeriert: Dies ist die Welt, wie sie sein sollte. Dies ist das neue Normal. Und wer etwas dabei störend findet, ist wahrscheinlich nur nicht modern genug.
„Emily in Paris“ ist kein Serienphänomen. Sie ist ein Zeitphänomen. Eine Art kulturelles Morphium, das die Sinne betäubt und das Denken formt. Mit Mode, Macarons und moralischer Schönheit.
Und wer das für harmlos hält, hat vermutlich auch mal geglaubt, Werbung beeinflusse ihn nicht.